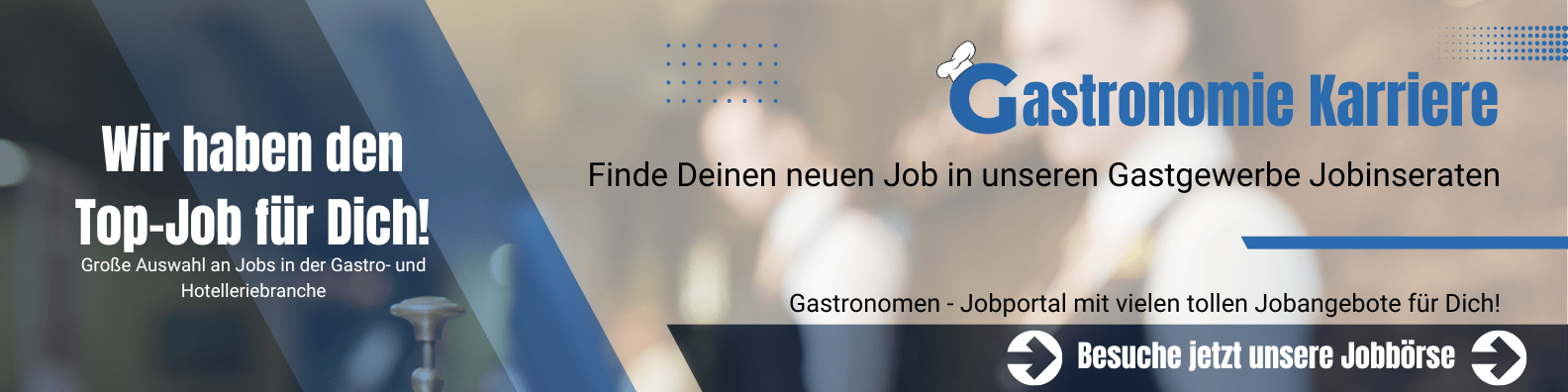Insbesondere die Burgundersorten sowie die Rotweine scheinen die Gewinner des Jahrgangs zu sein. Die Erntemengen schwanken allerdings recht stark von Region zu Region, je nach Rebsortenspiegel und klimatischen Gegebenheiten. Wie sich der Weinjahrgang 2025 im Detail in den 13 deutschen Weinanbaugebieten entwickelt hat, berichtet das Deutsche Weininstitut (DWI).
Ahr (533 ha)
Im Ahrtal, dem deutschen Rotweinparadies, hatten die Winzer in diesem Jahr gleich doppelt „Schwein“ – einmal leider im wortwörtlichen Sinne. Denn Wildschweine suchten in bislang unbekanntem Ausmaß die Frühburgunderanlagen heim und richteten erhebliche Schäden an, wie Hubert Pauly, Präsident des Weinbauverbands Ahr, berichtet. „Aber das war der einzige Wermutstropfen“, sagt Pauly.
Denn insgesamt erlebte die Region, die laut Ahrwein e.V. als größtes geschlossenes Rotweinanbaugebiet weltweit gilt, einen „Traumherbst“. Die Qualität der Trauben war hervorragend, und auch die Erntemenge stimmte die Winzer zuversichtlich – besonders nachdem die Region 2021 von einer verheerenden Flut getroffen worden war.
Während Spätfröste und Pilzkrankheiten den Mostertrag 2024 auf nur 16.000 Hektoliter reduziert hatten, flossen in diesem Jahr schätzungsweise 39.000 Hektoliter in die Keller – ein Plus von 144 Prozent gegenüber dem Vorjahr und acht Prozent über dem langjährigen Mittel.
Die Lese begann Mitte August mit dem Frühburgunder, der laut Ahrwein e.V. ein Mostgewicht von rund 100 Grad Oechsle erreichte. Lukas Sermann, Vorsitzender des Vereins, berichtete von kleinen Beeren mit hohem Schalenanteil, die aromatische, strukturierte Weine versprächen – auch ein Ergebnis der natürlichen Verrieselung während der Blüte. Zudem hätten kühle Nächte, moderater Regen im Juli und niedriger Pilzdruck optimale Voraussetzungen für einen vielversprechenden Jahrgang geschaffen. Die Weinberge präsentierten sich in bestem Zustand, und die Lese konnte bei stabilem Wetter zügig abgeschlossen werden. Eine aufwendige Selektion war kaum nötig, vereinzelte Regentage am Ende beeinträchtigten die Qualität nicht.
„Fruchtige Weine mit intensiver Farbe“ stellt Pauly insbesondere mit Blick auf die Rotweine in Aussicht, aus denen an der Ahr häufig auch Blanc de Noir erzeugt wird – vor allem aus der Leitrebsorte Spätburgunder. „Die Weine zeigen harmonische Fruchtsäuren und sind stark ausgeprägt“, so Pauly, der mit Blick auf Kellerarbeit und Qualität von einem echten Traumjahrgang spricht.
Baden (15.454 ha)
Größer als im Vorjahr, aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Mittel: So fiel die Weinmosternte 2025 im Anbaugebiet Baden aus. Nachdem 2024 Spätfrost und Pilzkrankheiten für Ertragseinbußen gesorgt hatten, waren es in diesem Jahr vor allem Hitze und Trockenheit, die den Reben zusetzten – insbesondere in der Phase von Mitte Juni bis Mitte Juli.
Schon Ende August zeichnete sich ab, dass es mengenmäßig kein großes Jahr werden würde. „Der Behang war in Ordnung, aber die Beeren waren doch recht klein, lockerbeerig und dickschalig“, erklärt Holger Klein, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbands. Die festen Beeren ließen sich schwer pressen und ergaben weniger Saft – ein Grund, warum die Erntemenge unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Schätzungen zufolge wurden rund eine Million Hektoliter Most eingebracht – fünf Prozent mehr als 2024, aber 15 Prozent weniger als im zehnjährigen Mittel.
Sehr zufrieden zeigten sich die Weinbauern mit der Qualität der Trauben, die bis zum Regen im September wirkten wie aus dem Bilderbuch. „So schöne Trauben habe ich selten gesehen“, sagt Klein. „Es war ein sehr unkompliziertes Vegetationsjahr in Baden – keine Krankheiten, kaum Starkwetterereignisse – eigentlich ideal“. Lediglich der Regen im September sorgte für Stress während der Lese.
Die Hauptlese begann offiziell am 9. September und war nach rund drei Wochen abgeschlossen – auch, weil viele Sorten gleichzeitig reif wurden. Trotz der Niederschläge konnte gutes Traubenmaterial eingebracht werden, insbesondere für Sektgrundwein, der bereits vor der Hauptlese aus „absolut perfektem Material“ gewonnen wurde.
Klein erwartet insgesamt fruchtbetonte Weißweine mit moderatem Alkoholgehalt und ausgewogener Säure, die dank der kühleren Nachttemperaturen eine sehr gute Aromenausprägung haben. Besonders gut abgeschnitten habe der Weißburgunder, sowohl in Menge als auch Qualität. Die sonst so ertragreichen Sorten Müller-Thurgau und Gutedel lieferten aufgrund kleinerer Beeren eher moderate Erträge. Insgesamt sei die Menge marktgerecht, so Klein – und die Qualität lässt auf einen vielversprechenden Jahrgang hoffen.
Franken (6.128 ha)
In den fränkischen Weinbergen herrschte in den ersten Septemberwochen wie andernorts auch hektische Betriebsamkeit. Die Vollernter seien Tag und Nacht gelaufen – mitunter habe er vier bis fünf davon in einer Anlage gesehen, erinnert sich Weinbaupräsident Artur Steinmann an die Lese, die in Rekordzeit über die Bühne ging. „Die Winzer wussten, dass nach dem 21. September Regen kommen soll“, sagt er, deshalb hätten sie vorher reinholen wollen, was geht. Wer es rechtzeitig schaffte, konnte sich über hervorragende Traubenqualitäten freuen.
Die Winzer zeigen sich mit dem Jahrgang sehr zufrieden. „Wir haben durch die Bank fantastische Weine“, resümiert Steinmann. Besonders die Rotweine profitierten: Sie sind intensiv gefärbt und haben reife Tannine. Auch die Weißweine überzeugen dank der geringen Erträge mit besonderer Strahlkraft.
Überrascht waren die Winzer vom Ertrag, der deutlich niedriger ausfiel, als erwartet. Mit schätzungsweise 432.000 Hektolitern übertraf er zwar die von Frostausfällen geprägte Ernte des Vorjahres um 38 Prozent, liegt aber nur um fünf Prozent über dem langjährigen Mittel. Auch Franken hatte mit der Trockenheit zu kämpfen. Zwar war die Wasserversorgung zu Jahresbeginn gesichert, aber im Mai und Juni mussten die Winzer ihre Junganlagen wegen Regenmangels bewässern. Der Regen im Juli sei ein Segen für die Weinberge gewesen, konstatiert Steinmann, sie hätten sich „super“ erholt. Auf eine weitere Hitzephase im August folgten kühle Nächte, die für eine gute Aromenentwicklung in den Trauben sorgten.
Regen leitete in den ersten Septemberwochen den zügigen Beginn der Hauptlese ein, die Ende September weitgehend abgeschlossen war. Steinmann spricht von einem „kühler gewachsenen Jahrgang“ mit frischen Weißweinen, die mit spritziger, lebendiger Fruchtsäure und schönen Aromen überzeugen. Besonders der Silvaner, die Leitrebsorte Frankens, zeigt sich mit frischer, ausgereifter Säure, intensiver Frucht und mineralischer Tiefe – begünstigt durch den Regen. Der Riesling reagierte mit seiner dünnen Beerenhaut hingegen empfindlicher auf die feuchten Bedingungen und musste stärker selektioniert werden.
Hessische Bergstraße (456 ha)
Im Anbaugebiet Hessische Bergstraße haben die besonders früh erreichten Mostgewichte die Winzer wie überall in diesem Jahr zu einer frühen Lese gezwungen. Laut Johannes Bürkle, Vorstandsvorsitzender des Weinbauverbands, brachten diese am Ende „absolut topp“ Mostqualitäten hervor.
Bereits in der vorletzten Augustwoche begann die Ernte der Trauben für Sektgrundwein – „aus erhöhter Not“, wie Bürkle berichtet. Die Zuckergehalte der Beeren waren so hoch, dass ein späterer Lesetermin zu hohe Alkoholgehalte im fertigen Sekt zur Folge gehabt hätte. Da auch andere Sorten bereits hohe Mostgewichte aufwiesen, startete direkt im Anschluss die reguläre Lese – und die verlief „sehr, sehr zügig“. Ab Mitte September sorgten wiederholte Regenfälle für steigende Fäulnisgefahr, während gleichzeitig viele Sorten gleichzeitig reif waren.
Während selbstvermarktende Betriebe an der vorderen Bergstraße bereits am 25. September mit der Lese fertig waren, dauerte sie bei den Genossenschaften teils bis Mitte Oktober – auch wegen wetterbedingter Pausen. Dennoch sei auch Mitte Oktober ein früher Zeitpunkt, so Bürkle: „Früher hat man teilweise bis in den November für die Rieslingernte gebraucht.“
Die Qualität der Moste sei „voll in Ordnung“, berichtet Bürkle. Die Mostgewichte lagen im oberen Bereich, manche Rieslingpartien wiesen sogar deutlich über 90 Grad Oechsle auf. Dieses Jahr könne man daher auch kräftigere Weine erwarten. Die Trauben waren aromatisch, insbesondere die Aromarebsorten wie Muskateller, Gewürztraminer, Scheurebe und Roter Riesling zeigten intensive Fruchtaromen – begünstigt durch den hohen Zuckergehalt. Auch früh gelesene Rotweine profitierten und versprechen gehaltvolle Tropfen. „Es gibt mit Sicherheit ein ganz ordentliches Rotweinjahr“, so Bürkle.
Der Riesling, Hauptrebsorte der Hessischen Bergstraße, wurde, obwohl er früh reif war, „aus Tradition“ zuletzt gelesen – und musste wegen des einsetzenden Regens stärker selektioniert werden, was die Erntemenge reduzierte. Insgesamt wird die Weinmosternte auf rund 27.590 Hektoliter geschätzt – das sind 15 Prozent mehr als im spätfrostgeprägten Vorjahr, aber elf Prozent weniger als im zehnjährigen Mittel.
Mittelrhein (451 ha)
Im kleinsten deutschen Weinbaugebiet, dem Mittelrhein, verlief die Weinlese 2025 laut Dr. Maximilian Hendgen, Geschäftsführer des Weinbauverbands Mittelrhein, aufgrund des vielen Regens „früh, stressig und schnell“. Dabei zeigte sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der von Steil- und Terrassenlagen geprägten Anbauregion, die sich von Bingen bis Bonn erstreckt. Der südliche Teil zwischen Trechtingshausen und Boppard war deutlich stärker vom Regen betroffen als der nördliche Bereich zwischen Leutesdorf und Bonn. Dort setzte die Entwicklung später ein, und die trockeneren Bedingungen führten zu einem sehr guten Herbst mit gesunden, hochreifen und aromatischen Trauben – auch beim Riesling, der rund 70 Prozent der Anbaufläche am Mittelrhein ausmacht. Die Erträge waren ordentlich bis leicht überdurchschnittlich, insbesondere bei den Burgundersorten.
Im südlichen Teil hingegen spitzte sich die Lage ab der zweiten Septemberdekade rasch zu. In den wärmeren Lagen am Rhein war Eile und eine starke Selektion geboten, was den Betrieben, die bis Anfang Oktober lasen, deutliche Mengeneinbußen bescherte. „Es war in diesem Jahr eine besonders anstrengende Lese, weil wir im September kaum trockene Phasen hatten“, so Hendgen. Der Regen machte die Steilhänge rutschig und erschwerte den Maschineneinsatz. Viele Betriebe verzeichneten Verluste von 20 bis 30 Prozent oder mehr – vor allem beim Riesling.
Trotz dieser Herausforderungen wurden schätzungsweise 23.000 Hektoliter Weinmost eingebracht. Dieses Ergebnis liegt zwar acht Prozent unter dem langjährigen Mittel, übertrifft jedoch den von Wetterextremen geprägten Vorjahresertrag um 44 Prozent.
„Die eingebrachten Qualitäten sind sehr gut“, betont Hendgen. Die Region biete in diesem Jahr alles, was der Markt verlangt – vom frischfruchtigen Kabinett bis zur gehaltvollen Auslese. Weiß-, Grau- und Spätburgunder sowie andere frühe Sorten wie Müller-Thurgau zeigten durchweg gute Ergebnisse. Auch der Riesling erreichte sehr gute Mostgewichte zwischen 80 und 85 Grad Oechsle, in besonders warmen Lagen wie dem Bopparder Hamm sogar 90 Grad und mehr. Die Säurewerte seien gut eingebunden, die Reife überzeugend – beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Jahrgang.
Mosel (8.445 ha)
Nach der kleinsten Ernte in 50 Jahren im Vorjahr sorgte der 2025er Jahrgang im Anbaugebiet Mosel für den frühesten Lesebeginn und das schnellste Ende der Ernte. Grund dafür waren kräftige Regenfälle im September, die laut Moselwein e.V. „auf den letzten Metern“ einen vielversprechenden Jahrgang trafen. Noch im Spätsommer präsentierten sich die Reben in hervorragendem Zustand – Ende August lag die Reifeentwicklung rund zwei Wochen vor dem Vorjahresniveau. Die einsetzenden Niederschläge zeigten ein deutliches Gefälle in ihrer Verteilung. „Je weiter man die Mosel runterkam, umso trockener war der September“, erklärt Dr. Maximilian Hendgen, Geschäftsführer des Weinbauverbands Mosel. Gepaart mit zeitweise warmen Temperaturen war der Regen ungünstig für den Gesundheitszustand der Trauben, insbesondere beim Riesling, der in über 60 Prozent der Moselweinbergen wächst.
Viele Betriebe reagierten mit einem sehr frühen Lesestart, an den sich nahtlos eine „Turbo-Lese“ anschloss, da viele Rebsorten gleichzeitig reif waren. Bereits in der ersten Septemberhälfte wurden Burgundersorten sowie Riesling für Sektgrundwein und Kabinett geerntet. Um den 19. September begann die Hauptlese des Rieslings, der Mostgewichte zwischen 70 und 95 Grad erreichte.
Während die frühen Sorten sowie Pinot und Elbling sehr gute Erträge bei hoher Reife und guter Traubengesundheit lieferten, gab es beim Riesling große Unterschiede. Weinberge, die 2024 von Frost betroffen waren, brachten in diesem Jahr gute Erträge bei mittlerer Reife hervor. In anderen Lagen hingegen blieben die Erträge oft unter dem Durchschnitt, bei gleichzeitig sehr guten Reifewerten. Besonders in den Steillagen musste stark selektioniert werden, was teils zu Einbußen von 50 bis 75 Prozent führte.
Trotz aller Herausforderungen wurden an der Mosel laut Schätzungen rund 780.000 Hektoliter Weinmost eingebracht – ein Plus von 52 Prozent gegenüber 2024 und elf Prozent mehr als im langjährigen Mittel. Damit zählt die Mosel zu den wenigen deutschen Weinbaugebieten, die 2025 mehr geerntet haben als im zehnjährigen Durchschnitt. Von der Menge her sei es „ein guter, normaler Herbst“, so Hendgen, und mit den Qualitäten sei man durchweg zufrieden.
Nahe (4.234 ha)
„Dass ein Winzer mal in den Herbstferien Urlaub machen kann, gab es noch nie“, sagt Harald Sperling, Geschäftsführer des Weinbauverbands Nahe. Doch in diesem Jahr waren nach einer der frühesten und schnellsten Lesen überhaupt bereits Anfang Oktober fast alle Trauben gelesen. Möglich und nötig war dies aufgrund der fortgeschrittenen Traubenreife und kräftigen Niederschlägen in der letzten Septemberdekade.
Zuvor hatten laut dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück günstige Wetterbedingungen – ausreichende Niederschläge, leicht überdurchschnittliche Temperaturen und ein warmer, trockener August – für einen guten Traubenbehang und gesunde Beeren gesorgt. Die Erwartungen an Menge und Qualität waren entsprechend hoch. Doch während die Mostgewichte bereits Anfang September deutlich stiegen und die Lese von Trauben für Traubensaft, Sektgrundwein und Fasswein früh begann, blieb die Mostausbeute in vielen Fällen hinter den Erwartungen zurück.
Zusätzliche Herausforderungen wie lokaler Hagel und Ertragsausfälle durch Spätfröste sowie teils intensive Traubenselektion drückten ebenfalls auf die Menge. Die finalen Ernteschätzungen wurden im Herbst zweimal nach unten korrigiert und liegen mit 246.000 Hektolitern um drei Prozent unter dem Vorjahr und knapp 21 Prozent unter dem langjährigen Mittel. „Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben“, zieht Sperling rückblickend Bilanz.
Mit der Qualität zeigt sich die Branche jedoch sehr zufrieden. Insbesondere wer es schaffte, vor dem großen Regen am 23./24. September zu lesen, konnte perfektes Traubenmaterial einbringen. Die Mostgewichte lagen teils im dreistelligen Bereich – ein vielversprechender Indikator für den Jahrgang. Die Weine zeigen sich fruchtig, mit ausgeprägtem Sortenaroma und gut eingebundener Säure. Man könne laut Sperling durch die Bank weg zufrieden sein, nicht nur beim Riesling, sondern auch bei Grau- und Weißburgunder sowie den roten Sorten. „Auf die Spätburgunder und den Dornfelder kann man sich ebenfalls schon freuen“, so Sperling mit einem optimistischen Blick auf den Jahrgang.
Pfalz (23.787 ha)
Sehr gute Qualitäten, aber Überraschungen bei der Menge: So dürfte der Jahrgang 2025 vielen pfälzischen Winzern in Erinnerung bleiben. Im zweitgrößten deutschen Weinbaugebiet liegt die geschätzte Weinmosternte von 1.850.000 Hektolitern 17 Prozent unter dem Vorjahreswert und 18 Prozent unter dem langjährigen Mittel. „Damit hatten nur wenige Erzeugerbetriebe gerechnet“, heißt es bei der Gebietsweinwerbung Pfalzwein. Ein wesentlicher Grund für die geringere Menge waren kleinere Beeren.
Nach Einschätzung von Bernhard Schandelmaier vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz ist dies auf Trockenphasen während der Zellteilungsphase zurückzuführen. Die kleineren Beeren führten zwar zu konzentrierten Aromen und hohen Mostgewichten, aber eben auch zu einem geringeren Volumen. Ein weiteres Jahrgangsphänomen: Alle Rebsorten wurden gleichzeitig reif, was Experten unter anderem auf die ausreichende Wasserversorgung in der Reifephase und die Vitalität der Reben zurückführen, zudem laufe die Reifeentwicklung in der Hitze schneller ab. Frühsorten kamen bereits Mitte August auf Mostgewichte im Qualitätsweinniveau, und weil die Oechslegrade rasch anstiegen, begannen Ende August viele Betriebe mit der Lese von Frühsorten für Federweißer, gefolgt von Burgundern für die Sektbereitung. „Der Herbst kam überraschend schnell und hat uns Winzerinnen und Winzer vor große logistische Herausforderungen gestellt“, sagt der 1. Vorsitzender von Pfalzwein e.V., Boris Kranz. Am 23. September war die Lese beendet – so früh wie selten.
Der Qualität tat das keinen Abbruch. „Die Trauben waren außergewöhnlich gesund, und das Lesegut verspricht hervorragende Weine“, so Kranz. Er erwartet einen Jahrgang mit Struktur, Finesse und Lagerpotenzial. „Winzer, die rechtzeitig angefangen haben, konnten beste Qualitäten in den Keller bringen“, sagt der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Reinhold Hörner. Besonders gut werde der Rotwein, er erwarte einen „supertollen“ Jahrgang. Winzer, die bis Mitte September noch nicht fertig waren, kamen in die Regenperiode, die eine stärkere Traubenselektionen erforderte und zur zügigen Lese der hochreifen Trauben zwang.
Rheingau (3.180 ha)
Im Rheingau begann die Rieslinglese in diesem Jahr so früh wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, die bis 1955 zurückreichen. Dies liegt laut Rheingauer Weinbauverband zum einen am Klimawandel, der bereits den Austrieb der Reben sowie die Blüte immer früher einsetzen lässt, zum andern mussten die Winzer in diesem Jahr wegen des vorhergesagten Regens schnell handeln, um gesundes Lesegut in die Keller zu bringen. Erste Erzeuger begannen bereits um den 20. August herum mit der Ernte frühreifer Sorten. Die Forschungsanstalt Geisenheim holte sogar schon „außergewöhnlich früh“ in der ersten Augustwoche Solaris ein, wie der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Dominik Russler berichtet.
Wer früh dran war, konnte das Lesegut noch vor dem Regen einbringen, der Mitte September für längere Zeit einsetzte. Die Niederschläge führten zwar zu Ertragsverlusten, dank guter Vorarbeit im Pflanzenschutz und bei der Laubarbeit konnten viele Betriebe dennoch überwiegend gesunde Trauben einbringen. Die Auspressquote war Russler zufolge niedrig, was für kleinere und sehr markige Beeren spreche. Dabei sei Trockenstress nur an einer Station registriert worden. „Aber manchmal muss man einfach sagen: Wir arbeiten mit der Natur, und das ist dann eben so.“ Schätzungen zufolge wurden 179.000 Hektoliter Weinmost geerntet, elf Prozent weniger als im Vorjahr und 17 Prozent weniger als im langjährigen Mittel. Während die Burgundertrauben mengenmäßig stabil blieben, lag der Riesling um zehn bis 15 Prozent unter dem langjährigen Schnitt.
Mit der Qualität der Trauben zeigt man sich im Rheingau sehr zufrieden, denn bis zum Regen hatte es dort überdurchschnittlich viel Sonne und Wärme gegeben. „Es deutete alles auf einen wirklich grandiosen Jahrgang hin“, sagt Russler. „Was ich bisher probiert habe, sind großartige fruchtbetonte, gut strukturierte Weine, die im auch Basisbereich beim Riesling genau das abbilden, was der Markt sich so wünscht.“ Im Spitzenweinbereich deckten die Weine laut Russler ebenfalls alles ab. So wurden hervorragende Spätlesen, Auslesen, Beerenauslesen und sogar Trockenbeerenauslesen mit Werten von deutlich über 200 Grad Oechsle „in erfreulicher Menge“ registriert.
Rheinhessen (27.671 ha)
Rheinhessen war in diesem Jahr die Region, die den größten Ertragsverlust hinnehmen musste. Schätzungsweise 1.930.000 Hektoliter Weinmost flossen im größten deutschen Weinbaugebiet in die Keller, das sind 26 Prozent weniger als im Vorjahr und 23 Prozent weniger als im zehnjährigen Mittel. Hoffnungen auf eine große Erntemenge seien „aufgrund markiger Beeren mit geringer Saftausbeute und oft lockereren, kleineren Trauben gedämpft“ worden, so das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück.
Entschädigt wurden die Winzer durch die Qualität des Leseguts, das Anfang September – vor Beginn des Regens – noch sehr gesund war und in vielerlei Hinsicht das Potential für einen außergewöhnlichen Jahrgang hatte. Maßgeblich zum besonders guten Gesundheitszustand trotz sehr weit fortgeschrittener Reife habe der trockene August beigetragen. „So gesunde Weintrauben hat es schon lange nicht mehr gegeben“, bilanziert die Schutzgemeinschaft Rheinhessen. „Wohl dem, der früh in die Lese gestartet ist“, zitiert Rheinhessenwein e.V. den Weinbaupräsidenten Jens Göhring, der zwar mit der Menge hadert, sich aber über aromentypische Weißweine und „super ausgereifte Dornfelder-Rotweine“ freut.
Laut DLR waren die Reben bis Mai gut mit Wasser versorgt. Die anschließende Trockenheit endete Ende Juli mit starken Regenfällen, lokal kam es auch zu großen Hagelschäden. Erste Reifemessungen am 18. August überraschten mit sehr weit fortgeschrittenen Mostgewichten, die Hauptlese begann Anfang September „extrem früh“ und verlangte den Winzern einen „fulminanten Endspurt“ ab, da frühe und späte Sorten gleichzeitig reif wurden. Der Mitte September einsetzende Regen erhöhte zusätzlich den Zeitdruck. Rebsorten mit kompakten Trauben und dünnschaligen Beeren wie der Riesling mussten zunehmend stärker selektioniert werden. Zu Beginn der zweiten Septemberdekade war die Hauptlese oft schon beendet. „Die Winzer können sich über hervorragendes Lesegut freuen“, stellt die Schutzgemeinschaft fest. „Das Ergebnis sind aromatische und harmonische Moste bzw. Weine, die sich bereits in der Gärung sowie im Jungweinstadium mit einer ausgezeichneten Qualität präsentieren.“ Besonders bei Rotweinen zeige der Jahrgang viel Potential.
Saale-Unstrut (858 ha)
Während einige Weinbaugebiete in diesem Jahr aufgrund hoher Mostgewichte so früh wie noch nie in die Lese starteten, schoben die Winzer im nördlichsten deutschen Anbaugebiet Saale-Unstrut den Erntebeginn nach einem ersten Anlauf noch einmal hinaus. Am 15. September startete man hauptsächlich mit Federweißem, legte dann aber eine Pause ein. „So richtig haben wir erst am 22./23. September wieder losgelegt“, berichtet der Präsident des Weinbauverbandes, Andreas Clauß.
Ein Grund für den späten Start waren die zunächst nicht überzeugenden Mostgewichte der verbreiteten Sorten Müller-Thurgau und Bacchus. Die Lese dauerte – unterbrochen von Regenpausen – bis zum 20. Oktober. Im Rückblick zeigen sich die Winzer dennoch „absolut zufrieden“.
Besonders gut schnitten die neuen robusten Rebsorten ab. Sie überzeugten mit sehr guter Traubengesundheit und hohen Mostgewichten. „Die konnten wir kerngesund bis zum Schluss hängen lassen“, so Clauß. Im Gegensatz dazu hatten Standardsorten wie Müller-Thurgau im Oktober mit der Gesundheit zu kämpfen. Bei den Rotweinsorten spielte die Kirschessigfliege eine Rolle, weshalb sie rechtzeitig geerntet werden mussten. „Alles in allem war es ein normaler, guter Herbst“, bilanziert Clauß.
Bei den Mostgewichten erreichten viele der neuen, robusten Sorten, die laut Clauß einen deutlichen Zulauf im Anbaugebiet haben, sehr gute Werte bis 100 Grad Oechsle und darüber. Ansonsten lagen Riesling und Weißburgunder „ganz normal“ zwischen 80 und 90 Grad. „Es wird insgesamt eher etwas schlankere und gut trinkbare Weine geben, also richtig typische, fruchtige Saale-Unstrut-Weine“, erwartet Clauß.
Bei der Erntemenge legte das Anbaugebiet im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 129 Prozent auf geschätzte 39.000 Hektoliter zu. 2024 hatten allerdings auch Spätfröste große Schäden angerichtet, so dass nur 17.000 Hektoliter Most zusammenkamen. Im Vergleich zum zehnjährigen Mittel liegt der diesjährige Ertrag des Anbaugebiets neun Prozent unter dem Durchschnitt.
Sachsen (529 ha)
Nach dem spätfrostbedingten Erntemengeneinbruch im Vorjahr freuen sich die Winzer in Sachsen über schätzungsweise 30.000 Hektoliter vom 2025er Jahrgang, ein deutliches Plus, auch im Vergleich zum langjährigen Mittel. Dabei sei es ein „recht unaufgeregtes Jahr“ gewesen, berichtet der Vorsitzende des Weinbauverbandes, Felix Hößelbarth, der sich an den 23er Jahrgang erinnert fühlt. Die Reben konnten sich insgesamt über eine gute Mischung aus Regen und trockenen Phasen freuen und zeigten ein gutes Wachstum. Zwar bekamen die spätreifen Sorten in der zweiten Septemberhälfte noch eine Regenperiode ab, es sei aber alles im grünen Bereich geblieben, so der Vorsitzende. Ganz ohne Herausforderungen lief das Jahr aber dann doch nicht ab. Die Kirschessigfliege, die eine kühlere, feuchte Witterung mag und auch im Gebiet Saale-Unstrut ihr Unwesen trieb, habe in diesem Jahr starke Präsenz gezeigt und die frühreifen roten Sorten stellenweise heftig befallen, so Hößelbarth. Sie werde eine Herausforderung bleiben. Und der Riesling bekomme mit der Klimaveränderung zunehmend Schwierigkeiten, weil er mit der feuchten Witterung im Reifestadium nicht so gut zurechtkomme. Nach der Ernte, die von Anfang September bis zur zweiten Oktoberwoche dauerte, fielen die Burgunder und der Traminer positiv auf. Die Trauben seien gesund und zeigten schöne Aromatiken, so Hößelbarth. Weiß- und Grauburgunder kamen auf Oechsle-Werte von 85 bis 90 Grad. Auch die neuen, robusten Rebsorten hätten wieder ihre Stärken gezeigt und seien gesund reif geworden. Als Beispiele nennt er Souvignier Gris, Cabernet Blanc, Sauvitage und Sauvignac. „Die neuen Weine sind genau das, was wir uns wünschen“, erklärt Hößelbarth. Frisch, aromatisch und mit einer lebendigen Säure – so, dass sie richtig Spaß machen und Spannung ins Glas bringen, ohne dabei zu alkoholreich zu sein. Genau für diesen Weintyp stehe die Region und „wir konnten ihn in diesem Jahr wieder hervorragend herstellen.“ Mit den Kollegen freut sich Hößelbarth darüber, dass nach dem Ernteausfall im Vorjahr für 2026 nun wieder ausreichend Weine im Keller sind. Wenn die nächsten Jahre so verliefen, sei das „vom Weinbau her gesehen keine schlechte Prognose“, sagt er.
Württemberg (11.179 ha)
In Württemberg beeindruckten Trauben, die weitgehend unbehelligt von Hagel und Krankheiten heranreiften und „im August wie gemalt ausgesehen hätten“, sagt der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Württemberg, Dr. Hermann Morast. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir rein optisch schon mal so schöne Trauben hatten.“ Weil Wasserversorgung und Temperaturen stimmten und die Blätter der Reben sehr vital waren, zog die Reifeentwicklung schnell an. Teils hätten die Mostgewichte um neun Grad Oechsle in einer Woche zugelegt, so Morast. „Das kennt man so nicht.“ Die Lese begann bereits Anfang September und wurde wegen der vielen gleichzeitig reifen Sorten und wegen Regens am Ende hektisch. „Viele Betriebe waren nach maximal drei Wochen durch“, sagt Morast.
Dank Investitionen in Traubenverarbeitung und Kühlmanagement konnten die Mengen aber bewältigt werden, die kleiner ausfielen als erwartet. Zwar übertraf die Ernte mit geschätzten 720.000 Hektolitern das von Frostschäden geprägte Vorjahr um sechs Prozent, sie lag aber immer noch um 22 Prozent unter dem zehnjährigen Schnitt. Sie sei über alle Rebsorten hinweg deutlich niedriger ausgefallen, als noch Ende August prognostiziert, beim Trollinger ein stückweit sogar eingebrochen, so Morast.
Die Gründe: Eine Trockenzeit im Juni traf die noch kleinen Beeren in der Phase der Zellteilung, weshalb sie kleiner blieben, aber dafür teils sehr herausragende Qualitäten erwarten ließen, wie etwa beim Riesling, Trollinger und Grauburgunder. Denn in den Beeren hätten sich Inhaltsstoffe und Aromen konzentriert und dieses Potential habe man aus dem Weinberg in die Keller bringen können. „Wir haben unglaublich fruchtige Jungweine“, bilanziert Morast. Die Rotweine seien sehr farbintensiv, der Lemberger habe zudem wegen hoher Mostgewichte ein gewisse Lagerfähigkeit. Aufgrund der kerngesunden Trauben konnten auch wunderbare, feinfruchtige Rosés kreiert werden. Die weiße Leitrebsorte Riesling überzeuge in diesem Jahr mit einer frischen Fruchtigkeit. Alles in allem: Ein Jahrgang, der laut Morast maximales Potential habe, zeitnah verfügbar sein und definitiv Spaß machen werde.